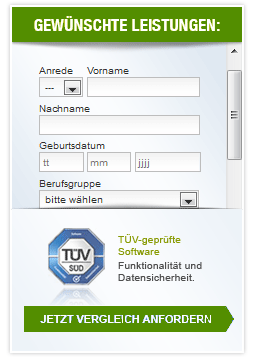Seit Mittwoch ist es offiziell, der Bundestag hat das zweite Pflegestärkungsgesetz beschlossen. Damit sollen vor allem Demenzkranke mehr Leistungen erhalten. Doch die Pflegereform hat auch Kritiker.
Die große Koalition hat am Mittwoch in einer Bundestagsabstimmung die lang diskutierte Pflegereform verabschiedet, die am 1. Januar 2017 in Kraft treten soll. Die wichtigsten Änderungen des neuen Pflegegesetzes: Statt drei Pflegestufen gibt es fortan fünf Pflegegrade, Demenzkranke wie Alzheimerpatienten, die nach dem alten System nur selten Leistungen erhalten hatten, sollen vom neuen Gesetz profitieren. 500.000 mehr Pflegebedürftige werden nach Aussagen des Gesundheitsministeriums künftig Leistungen beziehen können.
Diese Neuerungen bringt das Pflegestärkungsgesetz II.
Pflegekräfte fehlen schon heute
Derzeit leiden 1,6 Millionen Menschen in Deutschland an Demenz. Der Großteil von ihnen fiel bislang nicht in eine der drei Pflegestufen, die über Grad der Pflegebedürftigkeit und Höhe der Leistungen entscheiden, weil im alten Modell vor allem nach körperlichen Defiziten beurteilt wurde. Viele Demenzkranke sind körperlich gesund, benötigen aufgrund ihrer abnehmenden geistigen Fähigkeiten jedoch teils erhebliche Unterstützung im Alltag.
Die Bundesregierung verspricht sich von der Reform nun einen „gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung“. so Gesundheitsminister Hermann Gröhe. Schlechter gestellt werden soll, entgegen anders lautender Berichte, niemand. Ziel sei es, möglichst vielen Menschen, trotz Pflegebedürftigkeit, auch im Alter noch ein Leben zu Hause zu ermöglichen. Wie das in der Praxis genau funktionieren soll, ist bislang unklar. Die Opposition moniert, es gebe schon heute zu wenige Pflegekräfte.
Weitere Neuerung: Keine Minutenpflege mehr
Bislang wurde die Pflegebedürftigkeit eines Menschen daran gemessen, wie viele Minuten es dauert, ihn im Alltag zu unterstützen, z. B. 10 Minuten für das Essen oder zum Waschen. Diese „Minutenpflege“ wurde in der Vergangenheit heftig kritisiert, da teils um Minuten gefeilscht wurde und der Druck auf Pfleger und Pflegebedürftige sehr hoch war.
Das Modell wird daher nun abgeschafft, zu Gunsten eines Fragebogens, in dem acht Bereiche abgedeckt werden sollen. Neben der Frage, wie gut der Pflegebedürftige seinen Alltag selbst gestalten kann, unter anderem auch, ob und wie viele soziale Kontakte er besitzt. Dabei soll am Ende kein aufsummierter Minutenwert herauskommen, sondern ein Pflegegrad, aus dem sich die Höhe der Leistungen ergibt. Das soll besser funktionieren als das alte Minutensystem. Ob es das tatsächlich tut, wird die Zukunft zeigen.
Kritiker sagen: Die Zeitnot bleibt, trotz Pflegereform
Pflegekräfte sollen mit dem neuen Gesetz mehr Zeit für Pflege und Motivationsmaßnahmen erhalten, Kritiker bezweifeln das jedoch und bemängeln, dass es auch mit dem neuen System akute Zeitnot bei der Pflege geben wird. Denn die wird von den Pflegekassen in sogenannte Module unterteilt, z. B. für waschen oder anziehen. Für jedes Modul erhalten Pflegekräfte ein bestimmtes Entgelt. Wer sich zu lange an einem Modul aufhält, macht auf Dauer Miese. Die Zeitnot, einer der häufigsten Kritikpunkte am aktuellen System, wird also auch nach der Reform bleiben.
Genau wie der Fachkräftemangel. Bis 2060 rechnet sich Bundesregierung mit 4,7 Millionen Pflegebedürftigen, also rund dreimal so vielen wie heute. In der Branche fehle es aber schon jetzt an Pflegekräften. Ein ursprünglich geplanter Personalschlüssel für Pflegeheime, ähnlich dem Betreuungsschlüssel in Kindergärten, wurde in der Reform nicht umgesetzt. Stattdessen soll bis 2010 ein entsprechendes Personalbemessungskonzept erarbeitet werden.
Ach, und teurer wird die Pflege für Versicherte natürlich auch. Um all die Änderungen zu finanzieren, werden die Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung ab 2017 um 0,2 Prozent erhöht.